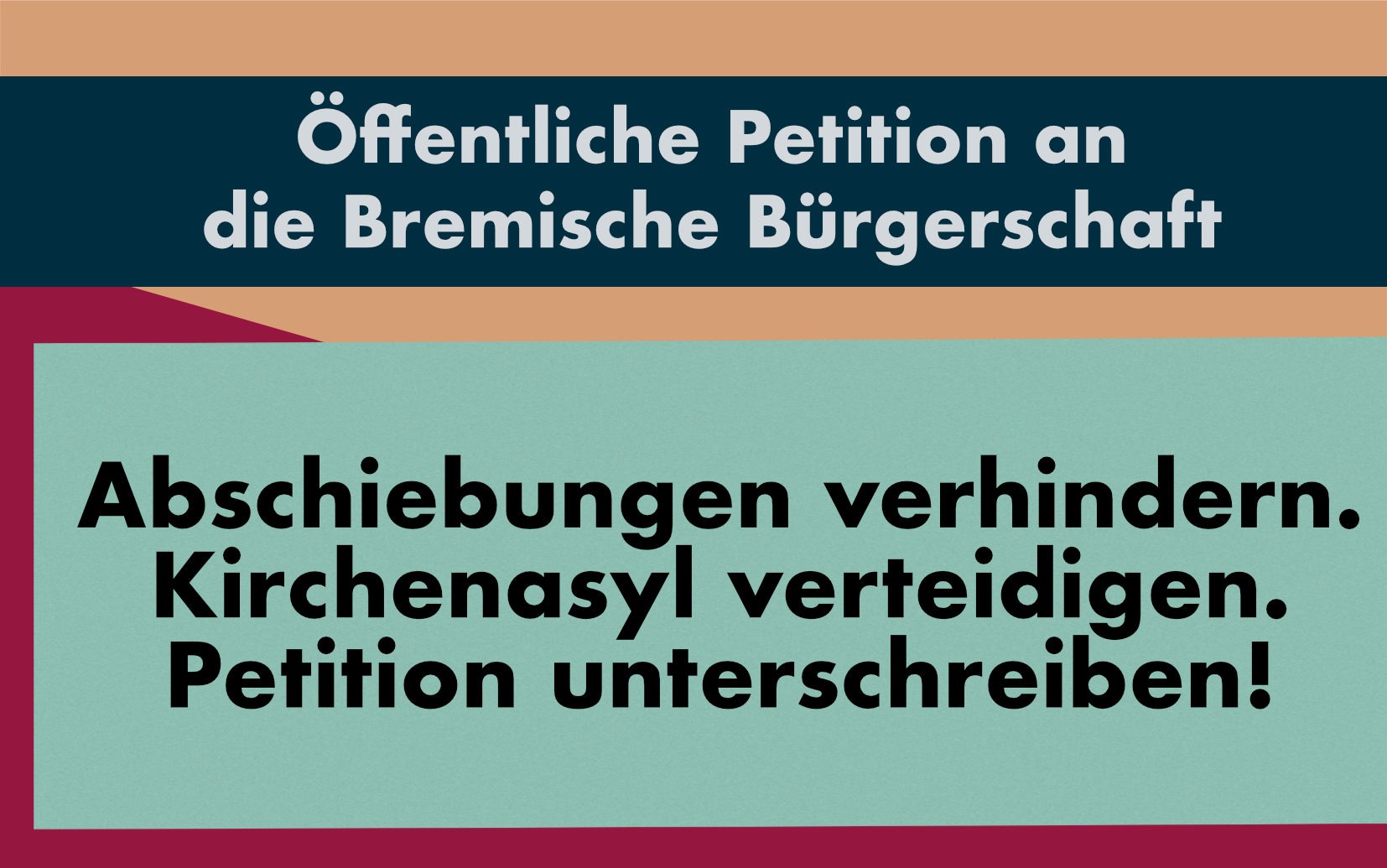Schutzsuchende Menschen werden in Lagern und Haftzentren ihrer Würde und häufig auch ihrer Rechte beraubt – das Recht auf Privatsphäe in den eigenen vier Wänden scheint für bundesweit für viele unerreichbar. Pro Asyl informiert in der aktuellen Kampagne #nichtmeine Lager über Hintegründe und Zustände nicht nur in Deutschland.
Eine unserer Aufgaben ist, eine kritische Öffentlichkeitsarbeit über die Lebenssituation von Flüchtlingen in Bremen zu machen. In den vergangenen Monaten ist in Bezug auf die Unterbringung viel passiert. Es konnten zwar fast 1000 Menschen im vergangenen Jahr in Privatwohnungen ziehen. Doch gleichzeitig wurden verschiedene neue Orte geschaffen, in denen Geflüchtete wohnen bzw. leben müssen.
Wir wollten uns ein Bild machen, einen Überblick verschaffen, sehen ob und worin sich die Unterkünfte/ Wohnheime/ Lager/ Mobilbauten unterscheiden. Wir sind ein Team von Acht. Manche von uns sahen die Bremer Unterkünfte zum ersten Mal, schauten sich bewusst mehrere davon an. Andere von uns kommen zum wiederholten Male oder sind auch in der Vergangenheit oft dort gewesen.
Wie müssen geflüchtete Menschen nach ihrer Ankunft in Bremen wohnen? Und wo?
Zum Zeitpunkt unserer Bestandsaufnahme im Frühjahr 2015 gibt es 15 Flüchtlingswohnheime in der Stadt Bremen. Hier leben Alleinstehende, Familien mit Kindern und manchmal auch Minderjährige ohne ihre Eltern – z.B. aus Syrien, Serbien, Afghanistan oder Eritrea. Geflüchtet vor Krieg, Verfolgung, struktureller Diskriminierung und vor Furcht um Leib und Leben.
Das Bild, dass sich uns bietet ist heterogen, aber gar nicht zufriedenstellend: Die in Bremen Schutz suchenden Menschen müssen in sanierten oder sanierungsbedürftigen ehemaligen Büro- oder Wohngebäuden, in (ehemaligen) Hotels, Hostels, in neu errichteten Containeranlagen, in Turnhallen oder in Fertighäusern aus den 90er Jahren wohnen.
Manche dieser Orte, dieser Unterkünfte liegen zentral, andere befinden sich im Gewerbegebiet.
Manche bestehen schon seit den 1990er Jahren, andere erst seit dem letzten Jahr, wurden gerade neu gebaut oder umgewidmet. Andere liegen außerhalb der Landesgrenzen, z.B. im Landkreis Osterholz.
Bewacht von einer Sicherheitsfirma, betrieben werden die Einrichtungen von Wohlfahrtsverbänden, die neben den Sozialarbeitenden auch Hausmeister und BewohnerInnen selbst einsetzen. Der Betreuungsschlüssel, der das Verhältnis von Mitarbeitenden zu BewohnerInnen definiert, liegt bei 2,5 : 100.
Hier warten Menschen, u.a. auf eine Entscheidung über ihren Asylantrag, auf eine eigene Wohnung,auf einen Schul- oder KITA-Platz für ihre Kinder und letztlich auf eine neue Perspektive.
INFO:
Mietobergrenzen:
Bei der Suche nach einer Wohnung ist es (nicht nur für Geflüchtete, die noch in einem Übergangswohnheim wohnen) wichtig, genaue Informationen darüber zu haben, wieviel Miete das Jobcenter/das Amt für Soziale Dienste höchstens übernehmen wird.
Folgende Infos ergeben sich aus der fachlichen Weisung der Senatorin für Soziales zu § 22 SGB II:
https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.95337.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
Projektkoordination Wohnraumvermittlung: Wechsel aus einem Übergangswohnheim in eine Wohnung
Unterstützung für Familien und Einzelpersonen bei der Suche nach geeignetem Wohnraum
Kontakt für VermieterInnen: Andrea Nolte-Buschmann (a.nolte-buschmann@awo-bremen.de),
AWO Bremen Beratungsstelle für Flüchtlinge, Tel.: 0421-24719018 und Tel.: 0421-3377187
Wir haben die bestehenden Einrichtungen besucht und wollen hier beispielhaft einen Einblick geben. Unser Resümee finden Sie hier.:
(1) Alle warten geduldig. Unablässig klingelt das Telefon
Wir haben einen Termin vereinbart und warten im Nebenraum des Büros der mittelgroßen, mehrstöckigen Einrichtung. Die Schlange der BewohnerInnen, die Fragen haben, ist lang und es werden beständig mehr. Alle warten geduldig. Unablässig klingelt das Telefon.
Die Erstaufnahme (ZAST) ruft an. Es werden dringend Plätze gesucht, aber hier sind alle Betten belegt. Es rufen auch KollegInnen aus anderen Einrichtungen mit Rechtsfragen an. Die Menschen in der Schlange haben Fragen zu den Briefen, die sie vom Sozialamt bekommen haben. Da die Schreiben auf deutsch verfasst sind, bleibt der Inhalt unverständlich. Warum wird Sozialhilfe monatlich gezahlt, Kleidergeld aber nur manchmal?
Wieso muss ich einen Antrag beim Jobcenter stellen, wenn ich doch Geld vom Sozialamt bekomme? Eine Wahnsinns- Bürokratie. Wir nehmen einen der Briefe vom Amt und verstehen selbst kaum, was da steht.
Nach einem Zeitungsartikel kommen viele AnwohnerInnen zur Einrichtung, die Sachspenden abgeben wollen. Diese können nicht gelagert werden und es gibt auch niemanden, der die Spenden annehmen und die Weitergabe organisieren kann. Andernorts gibt es separate Lagerräume und Ehrenamtliche, die die Dinge sortieren. Was fehlt sind Fahrräder, Kinderwagen oder Geschirr. Hilfreich wären auch Computer. In keinem Flüchtlingswohnheim ist WLAN oder ein Internetzugang vorgesehen.
Insgesamt gibt es in Bremen eine große Spenden-Bereitschaft, auch viele Ehrenamtliche bieten Unterstützung an. An der Grundstruktur ändert das nicht viel.
Es fehlt u.a. an qualifizierten, mehrsprachigen BetreuerInnen mit Erfahrung für Behördengänge und Übersetzungen. Die Zeit der in den Flüchtlingsunterkünften Beschäftigten ist begrenzt: Der offizielle Betreuungsschlüssel liegt bei 2,5 Vollzeitstellen für 100 Flüchtlinge. Runtergerechnet wäre das etwa 1 Stunde pro Person in der Woche – abzüglich der Zeit für die Organisation, etwa von Schul- und KITA-Plätzen, den Teamgesprächen, der administrativen Tätigkeiten, der Treffen mit MultiplikatorInnen oder Interessierte (wie uns) und der Arbeitszeit der Reinigungskräfte. Am Ende des Tages bleiben viele Anliegen der Menschen unausgesprochen, unerledigt oder müssen verschoben werden.
Die Telekom weigerte sich anfangs, einen Anschluss zu legen
Eine junge Frau, die auch arabisch spricht und eigentlich im Wohnheim als Übersetzerin arbeitet, sitzt im Nebenzimmer und wird von einer deutschen Anwohnerin befragt, die eine Wohnung zu vermieten hat. Sie macht sich Sorgen, weil die Wohnung frisch renoviert ist und sie nicht weiß, wer ihr garantieren wird, dass alles pfleglich behandelt wird, wenn Flüchtlinge dort einziehen.
Für die Wohnungssuche und -vermittlung wurde zusätzliches Personal eingestellt. Nicht selten sind diese MitarbeiterInnen aber ebenfalls mit dem Alltäglichen beschäftigt. Die Leiterin der Einrichtung erzählt, dass das alleine nicht zu schaffen ist. Seit Monaten arbeiten sie dort mit ihrer privaten EDV und ihren Privathandys. Sie telefoniert mit der Telekom, die sich weigert, hier einen Anschluss zu legen, weil es sich um eine Flüchtlingsunterkunft handelt.
(2) Hier ist keine Bar!
Ein ehemaliges Hotel, zentral gelegen. 4 Stockwerke, 15 Zimmer für 50 Menschen. Es liegt direkt neben einem Sex-Shop. An einem der Fenster des Hauses findet sich ein Hinweis, dass hier keine Bar ist. Ob öfter Menschen eintreten, die Nachtleben erwarten?
Zuerst als Notunterkunft eingerichtet, wird es erst seit etwa einem Jahr als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Der Hotelcharakter, das Temporäre, bleibt den Räumen eigen. Im Gegensatz zu einem Hotel haben sich die BewohnerInnen diese Unterbringung nicht selbst ausgesucht. Trotzdem würden manche Menschen weinen, wenn sie aus diesem Haus in die „Turnhalle“ umziehen müssen, hören wir.
Das Haus wirkt bereits von außen klein und beengt. Dieser Eindruck bestätigt sich, als wir eintreten. Kleine Zimmer, die aber wenigstens eine gewisse Privatsphäre erlauben. Das Büro ist voll mit Menschen, die sich unterhalten. Eine mehrsprachige Mitarbeiterin bearbeitet Anträge, die beim Jobcenter eingehen müssen. Da die Amtssprache Deutsch ist, können manche Menschen die Formulare nicht verstehen und ausfüllen, geschweige denn sich beim Amt verständlich machen. Hilfe von Menschen mit Sprachkenntnissen scheint unabdingbar. Trotz der Enge im Haus, herrscht eine freundliche Atmosphäre.
Ein Spielzimmer oder einen nahegelegenen Spielplatz für die Kinder gibt es nicht. Sie spielen im Flur. Der Hall der Geräusche führt automatisch zur Belastungsprobe für die Ohren aller. Den BewohnerInnen steht ein karger Hof zur Verfügung, der vor allem in den wärmeren Monaten gerne genutzt wird.
(3) Umgeben von Wiesen
Im Bremer Osten wurde ein ehemaliges Schwesternwohnheim umgewidmet. Es liegt umgeben von weitläufigen Wiesen, in schöner Umgebung. KITA, Krankenhaus und Seniorenwohnheim in direkter Nachbarschaft. Neben dem Gebäude gibt es einen eigenen kleinen Spielplatz. Draußen ist es noch kühl. Die meiste Zeit verbringen die Menschen im Flur. Hier wird viel kommuniziert. Am Schwarzen Brett hängen Infos zum UnterstützerInnen-Kreis und der Waschplan für die Nutzung der Waschmaschinen und Trockner. Eine unabhängige Rechtsberatung oder ärztliche Sprechstunden vor Ort fehlen. 56 Plätze sind im Wohnheim vorgesehen. Es ist voll belegt.
Ein Gemeinschaftszimmer wird ausschließlich nachts vom Wachdienst genutzt
Der Gebäudezustand sehr gut, wirkt wie frisch renoviert. In der Nähe befinden sich Apartments, für weitere 35 Menschen. Dem Grundriss nach sind die Apartments groß genug (mit eigener Küchenzeile und Bad). Im Wohnheim ist die Privatsphäre eingeschränkt. Hier teilen sich die BewohnerInnen die Herde und Sanitäranlagen. Und es gibt drei Waschmaschinen für alle. Eine scheinbar übliche Quote.
Die Küchen erscheinen groß genug, es gibt genügend Kochstellen. Die Duschen und Toiletten sind abschließbar. Wir sehen ein einladendes Kinderspielzimmer. Das ist leider nur zu bestimmten Zeiten nutzbar – wenn sich eine Aufsicht findet. Für die Deutschstunden (Angebote der VHS und von Ehrenamtlichen) steht ein Kursraum zur Verfügung. Währenddessen werde eine Kinderbetreuung gewährleistet, wird uns berichtet. Das Gemeinschaftszimmer wird ausschließlich nachts vom Wachdienst genutzt. Es gibt Überlegungen, es auch für die BewohnerInnen nutzbar zu machen, denn einen frei zugänglichen Gemeinschaftsraum gibt es nicht.
(4) In Zukunft soll hier ein Fernseher stehen
In Tenever steht, wie in Arbergen, eine neue Containeranlage. Hier liegt sie direkt neben einem Kirchengemeindehaus und einer Schule, deren Fußballplatz mit genutzt werden kann.
Der erste Eindruck ist recht steril. In der Präsentation der Sozialbehörde wirkten die Container wohnlicher. Die Leiterin und ihre Stellvertreterin gehen mit uns gemeinsam durchs Haus. Wir sprechen über strukturelle Probleme, wie z.B. die fehlende Nachsorge durch Hebammen. In der Einrichtung gibt es relativ viele Schwangere und Mütter mit Neugeborenen. Auf den Fluren treffen wir viele Menschen. Hier kommt von irgendwo her ein schwaches WLAN-Signal, dass sich nutzen lässt.
Innen sehen wir neu gestrichene, aber kahle Wände. Die Räume sind frisch bezogen. Es sind genügend Kochplätze vorhanden, die Anzahl der Sanitäranlagen ist ausreichend. Der an die Küche schließende Gemeinschaftsraum ist fast unmöbliert, da die knapp 100 BewohnerInnen die Stühle und Tische lieber mit in die Zimmer nehmen. In Zukunft soll hier ein Fernseher stehen. Das Kinderspielzimmer ist, wie andernorts auch, nur unter Aufsicht nutzbar. Das eigentliche Arztzimmer wird als Spendenlager genutzt. Es soll zwar eine ärztliche Sprechstunde geben, doch offensichtlich gibt es nicht genug Personal, um auch in dieses Wohnheim zu kommen.
Außerdem kommen manche BewohnerInnen heraus, um wieder einmal meinem Baby, welches mich begleitet, Hallo zu sagen und ihre Kinder vorzustellen. So lernen wir auch eine Familie aus dem Kosovo kennen. Die Kinder sind größtenteils schon in der Schule und sie warten jetzt darauf, alle gemeinsam in eine eigene Wohnung zu ziehen. Bei der Suche hilft ihnen eine Wohnungsberaterin. Die Familie scheint mit der derzeitigen Unterbringung jedoch für den Übergang zufrieden zu sein. Obwohl die Container erst einmal nicht sehr wohnlich wirken, sind die Sanitäranlagen und Küchen (wenn auch geteilt) ausreichend, sauber und neu. Sie wahren die Privatsphäre.
Da das Wohnheim erst vor ein paar Wochen errichtet wurde, wirkt das Außengelände noch sehr kahl – für den Frühling sind jedoch ein Spielplatz und eine Grillfläche geplant.
Die Helfer*innen kommen fast täglich
Was die Angestellten als Angebot im Moment nicht leisten können, wird in einem großen Maß von Freiwilligen aufgefangen. Manche HelferInnen kommen fast täglich. Auch die Nachbarschaft engagiert sich und es gab kaum Proteste vor der Eröffnung der Unterkunft. Ein Bäcker schenkt Brot und die Schule spendet Obst. Es gibt einen großen UnterstützerInnen-Kreis, der sich monatlich trifft. Angebote aus der Umgebung werden zunehmend gut angenommen (Hoodtraining, Hip Hop Tanzen). Die umliegenden Umsonstläden sind wichtige Anlaufstellen (“nullkommanix” für Haushalt und Elektronik, “kostnix” für Kleidung).
Vergleich der Wohn- und Grundstücksfläche im selben Stadtteil für 100 Personen (in Containern, links) bzw. 8 Personen in Mehrfamilienhäusern mit Garten.
(5) Übersee
Im Bremer Westen, auf einer kleinen Anhöhe, steht ein Container-Ensemble, das seit ein paar Monaten erst Flüchtlinge beherbergt. Auf der angrenzenden Bahnlinie werden Güterzüge bewegt, ein Schild weist auf die sich entwickelnde Überseestadt hin. Hier, im ehemaligen Hafengebiet, steht die Hochschule für Künste, siedeln sich junge Unternehmen an, wird ein neuer Stadtteil entwickelt. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (GEWOBA) errichtet zum Teil geförderten Wohnraum – für 11 €/ qm. Das ist das Resultat politischen Engagements.
Etwas abseits, wo sonst der Zirkus gastiert, wurde kurzfristig, temporär gebaut. Es sind noch nicht alle Gehweg-Platten verlegt, da sprechen Verwaltung und Politik bereits über einen Ausbau der neuen Einrichtung. Die bisher 120 Plätze für Geflüchtete sollen auf 180 erweitert werden. Auch hier ist alles neu: Die Wände sind weiß, der Träger ist neu, die BewohnerInnen gerade in Deutschland angekommen. Aus Kriegsgebieten, geflohen vor strukturellem Rassismus, Gewalt oder Verfolgung sollen Sie hier Ruhe finden. Der Fotograf des Architekten macht zeitgleich Aufnahmen für eine zukünftige Präsentation.
Wir haben Zeit zu sprechen, Informationen auszutauschen, über Rechtsberatung oder über Sportvereine und um in die Zukunft zu schauen. Wir tauschen Adressen aus.
Der Gebäudekomplex aus Containern, „Mobilbauten“ genannt, sieht Gemeinschaftsräume vor, die aber schon als Notunterkunft für weitere Personen genutzt werden. Für diese Personen ist eine Fremdverpflegung vorgesehen, denn im Gegensatz den anderen BewohnerInnen stehen den NotunterkünftlerInnen im Gemeinschaftsraum keine Kochgelegenheit zur Verfügung.
Die Menschen haben keine Wahl.
Deutschkurse gibt es hier für alle BewohnerInnen, Schulplätze für die Kinder, Spenden und Ehrenamtliche, die Hilfe anbieten. Auch gibt es eine Kleiderkammer und ein Willkommen-Café. Kontakte zu ÄrztInnen sind entstanden, zu Einrichtungen und Initiativen. Das bezeugt Entgegenkommen der Nachbarschaft. Es ist Mittag. Der Lieferservice, der auch das Essen in der ZAST kocht, bringt den NotunterkünftlerInnen ihre Ration. Einige Erwachsene und ihre Kinder betrachten den entstehenden Spielplatz. Persisch ist zu hören, arabische und einige serbische Worte.
Der Straßenlärm bleibt unerwartet zurückhaltend.
Drinnen nimmt die Zahl der Fragenden zu. Ein Mitarbeiter ist für die Wohnungssuche zuständig, ein anderer kann übersetzen. Eingeschult sind alle, aber KITA-Plätze fehlen, hören wir. Die Anmeldefrist ist gerade abgelaufen. Dafür sind einige Gebäudeteile, wie in den baugleichen Einrichtungen, barrierefrei zu erreichen. Es ist ein unfertiges Bild. Vieles wird sich einspielen, Kreativität ist gefragt.
(6) Donnerstags gibt es Sport für Kinder und vielleicht auch bald eine kleine Bibliothek
In Hastedt besuchen wir gemeinsam eine der ältesten Flüchtlingsunterkünfte in Bremen. Sie besteht schon seit ca. 25 Jahren. Das bestätigt der erste Eindruck: Das Gebäude wirkt alt und renovierungsbedürftig. Wir sind mit der Leitung des Hauses verabredet. Wir werden gebeten, ein wenig zu warten. Und sind dabei nicht die einzigen. Die Schlange vor dem Büro wird immer länger, immerhin wohnen mindestens 260 Menschen in dem Haus. Hoffentlich kann sich die Leitung zumindest ein paar Minuten Zeit frei machen, um unsere Fragen zu beantworten.
Während der Wartezeit hilft meine Kollegin arabischsprechenden BewohnerInnen mit der Übersetzung deutscher Behördenpost. Wir stehen im dritten Stock: Junge Mütter kämpfen sich mit ihrem Kinderwagen die Treppe rauf oder runter – einen Fahrstuhl gibt es nicht. Die Hausordnung hängt am schwarzen Brett. Daneben eine spezielle Version für Kinder. Donnerstags gibt es ein Sportangebot für Kinder im Haus und mittwochs eine Frauengruppe mit Deutschunterricht.
Im Seminarraum hören wir von den Herausforderungen, mit denen die Angestellten tagtäglich konfrontiert sind. Sicher gebe es Mängel in dem Haus, aber es fehle am Geld und auch dem Platz, um mehr anzubieten. Es ist geplant, eine kleine Bibliothek einzurichten, in der es zwei PCs mit Internetanschluss geben soll. Dann kommt uns wieder die Bewohnerzahl von 260 Menschen in den Sinn. Eine Rechtsberatung vor Ort sei hingegen nicht geplant. Zweimal pro Woche gibt es einen Deutschkurs, der von Ehrenamtlichen gemacht wird. Es gibt Bedarf für einen Alphabetisierungskurs. Aber auch dafür fehlen die Ressourcen. Und dann drängt die Zeit. Wir verabschieden uns und treffen uns mit BewohnerInnen des Hauses, die meine Kollegin bereits kennt.
„Wir haben Glück gehabt.“
Die 4 Männer aus Syrien und Ägypten wohnen im Keller des Gebäudes. Sie laden uns in ihr Zimmer ein, dass sie seit einigen Monaten teilen. Über die Zeit haben sie die Standardausrüstung (Betten, Spint, Tisch, 4 Stühle) aufgestockt und es gibt ein Sofa, Sessel, einen zweiten Kühlschrank und einen Fernseher. Wir bekommen Tee angeboten, besonders herzlich wird mein Sohn empfangen. Die Männer haben alle große Sehnsucht nach ihren Babys in der Heimat. Dann beginnen sie von dem Leben im Haus zu erzählen.
Es könnte schlimmer sein, aber es könnte auch viel besser sein. „Wir haben Glück gehabt und ein relativ großes Zimmer bekommen“, sagt einer von ihnen. Doch es ist im Keller und daher dunkel. Im Sommer voller Gestank und Fliegen, weil die Mülltonnen unweit vom Fenster stehen. Zwar hat jedes Zimmer eine eigene Küchenecke und Badezimmer, aber alles ist sehr marode und häufig defekt. Die Männer erzählen auch von fehlenden Angeboten, wie Rechtsberatung, Hilfe bei Übersetzungen der behördlichen Schreiben, auch eine ärztliche Betreuung finde nicht statt.
Der Gemeinschaftsraum wäre einmal an Weihnachten geöffnet gewesen.
„Hier herrscht viel Langeweile“, hören wir zum Abschied.
(7) Abseits der Stadt
Hinter Grolland, nahe der Ochtum liegt das umzäunte Gelände, das wir suchen. Gegenüber dem Recyclinghof abseits der Stadt. In der Nähe befinden sich Schrebergärten.
Früher hielt hier ein Bus.
Heute beginnt der Weg der BewohnerInnen zur Schule und zum Einkaufen erst einmal zu Fuß. Die nächste Bushaltestelle ist 1 Km entfernt. Die Huchtinger Einrichtung entspricht daher am ehesten dem Bild eines Lagers. Gleichzeitig verfügt sie über ein großes Außengelände.
Ehrenamtliche haben hier Hochbeete und einen Lehmofen installiert.
Der Flachbau aus den späten 1990er Jahren wurde in den 2000er Jahren erweitert und ist heute für 180 Personen ausgelegt.
Das U-förmige Gebäude ist aufgeteilt in 2- und 4-Bett-Zimmer, einige Apartments, Gemeinschaftsduschen und –küchen sowie Büroräume und umschließt einen Platz mit Sandkiste und Bänken.
Drinnen führen die schmale Flure zu den Duschen, für deren Nutzung ein Plan aufgehängt ist.
Auch in den Zimmern ist es eng, wie in den meisten Einrichtungen; Ihnen stehen etwa 7 qm/ Person zur Verfügung.
Ist das ausreichend? Ist Freiheit überhaupt messbar?
Es ist kein Platz für Schreibtische. Schularbeiten werden auf dem Boden oder auf dem Bett gemacht.
Die Vernetzung im Stadtteil ist gut. Dortige Initiativen, Einrichtungen und Vereine kooperieren gerne. Fahrräder und Kleidung werden gespendet.
Können die BewohnerInnen des Wardamms erst einmal in Wohnungen ziehen, tun sie dies vorzugsweise im gleichen Stadtteil.
Nichts desto trotz umgibt den Ort das Gefühl der Ausgrenzung und Abgeschiedenheit. BewohnerInnen bestätigen dies, zurückhaltend, auch weil sie nicht fordernd wirken wollen oder ängstlich sind. Oder beides.
Integrations- und Infrastruktur, wie etwa Ärzte, die Bank, Supermärkte, Cafés, Treffpunkte, Schulen und KITAs, sind wie gesagt weit weg.
Trotz aller Bemühungen können Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben so nicht stattfinden.
„Warum müssen wir so leben?“
Das fragt uns ein vielleicht 10jähriger Junge als wir am Eingang stehen. Dieselbe Frage habe ich schon vor Jahren schon einmal gehört. Am selben Ort, nur von einem anderen Kind.
(8) Ein „Kaufhaus“, aber keine KITA-Plätze
Wir sind in einem Übergangswohnheim, welches neben Containern auch die Turnhalle der ehemaligen Schule als Unterbringung für Geflüchtete nutzt. Zunächst betritt man die ehemalige Aula, die auch als Gemeinschaftsraum dient. Kinder spielen an einem Kicker.
Im Gespräch mit den dort Beschäftigten geht es auch um die Wohnungssuche und um die anschließende Perspektive der BewohnerInnen. Wir hören von den Schwierigkeiten, besonders für große Familien Wohnungen zu finden. Es gibt zwar eine Kooperation mit der Gewoba, die können aber vornehmlich 3-Zimmer-Wohnungen anbieten. Ein weiteres Thema ist die adäquate Nachbetreuung der Menschen, die aus den Wohnheimen ausgezogen sind.
Dann sprechen wir über das Wohnheim. Wie gesagt, es handelt sich um eine ehemalige Schule, die 2013 aufgrund von Schimmelbefall geschlossen wurde. Es besonders bedauerlich, dass nur wenige Klassenräume genutzt werden könnten und stattdessen die Menschen in der Turnhalle schlafen müssen. Die Unterbringung in der Turnhalle ist nur für den äußersten Notfall eingerichtet worden. Momentan sind jedoch die dortigen 30 Schlafplätze immer belegt.
Aus Zeitgründen gibt es keine ärztliche Sprechstunde in der Einrichtung. Noch immer arbeitet nur eine Ärztin für das Gesundheitsamt und kann nicht in allen Einrichtungen sein. Und auch eine Rechtsberatung gibt es nicht. Wenn es Bedarf für einen rechtlichen Beistand geben sollte, würden sich die Geflüchteten selbst darum kümmern, so die Erfahrung der Angestellten. Ein weiteres großes Problem sind die fehlenden KITA-Plätze. Es werde versucht, die Kinder unterzubringen, aber es gäbe einfach zu wenige Plätze.
Jemand hört Musik, alle anderen hören mit
In der Turnhalle sind einzelne Abteile abgetrennt. Allerdings ohne Tür, sondern nur mit einem dünnen Vorhang. Eine Tür fehlt ebenso wie eine Rückzugsmöglichkeit. Jemand hört Musik, alle anderen hören mit. Die Sanitäranlagen bestehen aus den alten Großraumduschen für den Sportunterricht. Der Geruch in der Halle ist eine ungeliebte Kindheitserinnerung: Blaue Matten voll mit (Angst)Schweiß junger SchülerInnen.
Wir schauen uns auch das hauseigene „Kaufhaus“ an. Die Kleidung und Gebrauchsgegenstände werden wie in einem Secondhandladen sortiert und für wenig Geld angeboten. Wie in manch anderem Wohnheim, kann sich auch dieses vor Sachspenden kaum retten.
Freiwillige Helfer sortieren die Artikel und geben sie dann aus. Manche auch gegen einen geringen Geldbetrag. Die Einnahmen gehen an die Cafeteria des Wohnheims. Zum Ende sprechen wir mit einigen Bewohnern des Hauses. Eine Handvoll Männer mittleren Alters sitzt im Foyer und isst Sonnenblumenkerne. „Hallo“, beginnen wir. Freundliche Blicke und Worte antworten uns. Wir unterhalten uns und stellen fest, wie schwer es ist, deutsch zu lernen.
(9) Hell und freundlich
Unser nächster Besuch führt in ein komplett saniertes Gebäude an einer vielbefahrenen Straße. Ein mehrstöckiges Haus, zentral gelegen, das sich unauffällig in die Gebäudezeile einfügt. Das Wohnheim wurde 2013 eröffnet, kann mit 57 Personen belegt werden und verfügt fast ausschließlich über Apartments.
Der Eingangsbereich ist hell und freundlich, Sofas stehen um einen Tisch. Menschen kommen und gehen, manche unterhalten sich. Wir sehen einige Mütter mit Kinderwagen. Einen Sicherheitsdienst gibt es nicht.
Vor und im Büro der Heimleitung herrscht reger Betrieb. Angeregt erzählt sie von ihrer Arbeit. Im Gespräch klingt rasch an, dass es zu wenig bezahlte Stellen für die dringlichen Bedürfnissen der Menschen gibt. Aber auch Sorgen über die Angehörigen, etwa aus Syrien, beschäftigt die Menschen. Der Hausmeister springt ein, wenn das Büro nicht besetzt ist.
In einer Gemeinschaftsküche stören wir unabsichtlich eine junge Frau. Sie sitzt am Tisch und weint. Rückzugsmöglichkeiten stehen außerhalb der privaten Wohnräume nicht zur Verfügung. Viele der Bewohnerinnen sind schwanger oder Mütter, das erklärt auch die Kinderwagen im Eingangsbereich. Ältere Kinder wohnen in diesem Haus nicht.
Zahlreiche Sachspenden finden ihren Weg in das Haus. Trotzdem fehlen praktische Dinge. So suchen die BewohnerInnen nach Wasserkochern und Kaffeemaschinen, die seltener gespendet werden als Bekleidung. Eine übergeordnete Koordination der Spenden, um sie auf die verschiedenen Häuser zu verteilen, scheint notwendig.
Ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten fällt ins Auge: Hinweiszettel und Ankündigungen verweisen auf Freizeitangebote von Ehrenamtlichen und deren Hilfestellung in den verschiedensten Bereichen. Dennoch mangelt es an Fachkenntnissen oder auch einfach an Sprachkenntnissen, die bei einigen Anliegen notwendig sind. Die vom Staat bereitgestellten Kapazitäten reichen trotz der Unterstützung der Freiwilligen nicht aus, um zu erledigen, was getan werden muss.
(10) Vom Gesundheitsamt geschlossen
Als wir die damalige ZAST in der Steinsetzerstrasse besuchten, war es noch keine teilstationäre Einrichtung des Jugendamts. Sondern noch die vor Jahren eingerichtete Erstaufnahmestelle, in der zunehmend auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht wurden.
Geplant für 260 Personen, sind in der Einrichtung zeitweise über 310 Personen gemeldet. Die ZAST ist trotz derjenigen, die bei Verwandten und Freunden wohnen, hoffnungslos überbelegt. Der Träger hatte vergangenen Herbst gegenüber der Presse selbst von einem „drohenden Kollaps“ gesprochen.
Es ist gerade Essenszeit und der Tag zum Wechseln der Bettwäsche. Das ganze Haus riecht nach Essen und die Flure sind voller Menschen mit weißen Laken. Wir sehen Aushänge zu Angeboten, die zum Teil von Ehrenamtlichen geleitet werden.
Gegessen werden kann in der Kantine dreimal täglich zu festen Uhrzeiten. Da sie nur gute 50 Sitzplätze hat, muss dies Schichtweise passieren. Das Mitnehmen der Speisen auf die Zimmer ist untersagt; selbst zu kochen ist nicht vorgesehen. Die Sanitäranlagen, also die Duschkabinen mit minimalem Verdeck, sind direkt vom Flur aus zusehen. Ein unbeobachtetes Umziehen ist eine Herausforderung. Auf der benachbarten Toilette fehlt das Klopapier.
Menschen, die auf den Fluren schlafen, sind nicht zu sehen.
Auf dem Flur spielen Kinder Fußball. Die Jugendlichen, zwei junge Syrer, die wir besuchen, sind alleine nach Deutschland gekommen. Der eine von Ihnen ist erst am Tag zuvor angekommen. Der Andere ist seit ca. zwei Wochen hier. Er spricht sehr gut Englisch. In Syrien ging er zum Gymnasium. Er soll auch bald eine deutsche Schule besuchen, allerdings in Bremen-Nord, das gefiele ihm nicht, sagt er, er möchte lieber im Zentrum bleiben.
Einige Wochen später besuchen wir noch einmal die ZAST. Dieses Mal treffen wir einen Mann aus dem Irak, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern erst seit wenigen Tagen in der ZAST untergebracht ist. Wir stellen ihm Fragen zu seinem Leben hier. Er wiederholt, wie kinderunfreundlich das Essen sei. Auch der Mangel an Platz zum Spielen für seine Kinder sei ein großes Problem. Anderen Umständen scheint er gleichgültig gegenüber zu sein. Er lädt uns in das Zimmer seiner Familie ein, es ist ihm sehr unangenehm, dass er uns keinen Tee anbieten kann. Er erzählt uns davon, was ihn wirklich beschäftigt: „Ich finde keine Hilfe im Haus“.
Wir übergeben ihm Adressen von Beratungsstellen. Danach treiben wir uns wieder auf den Fluren rum, um zu sehen mit wem wir vielleicht noch sprechen können, wir sind aber auch dieses Mal nicht angemeldet und werden auch kurzer Zeit gebeten zu gehen.
„Von einer Gefährdung des Kindeswohls kann nicht die Rede sein“, sagt der Sprecher der Sozialbehörde, David Lukaßen, gegenüber der taz 2013. „Doch wir tun alles, um sie schnellstmöglich in altersgerechten Einrichtungen unterzubringen.“
Zwei Jahre später wird die Einrichtung vom Gesundheitsamt vorübergehend geschlossen. Einige der mittlerweile 200 dort lebenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), die dort für Wochen und Monate statt nur für 3- 5 Tage, wie die Bremer Jugendbehörde vorgibt, wohnen müssen, werden in Zelten untergebracht…
Das abschließende Resümee finden Sie hier.
Unsere Recherchen beschränkten sich auf das Stadtgebiet Bremen und schlossen bewusst Einrichtungen für Minderjährige aus, die (eigentlich) nach einem speziellen (KJHG-) Standard untergebracht werden müssen. Fotos: privat